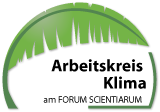|
|
Vorträge im Wintersemester 2009/10Im Wintersemester 2009/10 fand die vierte Vortragsreihe im Rahmen des Arbeitskreises statt.
☛ Folien zu den Vorträgen gibt es nach Login hier.
16. November: Verhandlungsstrategien unter der KlimarahmenkonventionReferent: Matthieu
23. November: Wiederaufforstungsarbeit in Kenia mit der NGO Green Belt MovementReferentin: MalinUm den "Mau Forests", dem größten Wald und Wasserspeicher Kenyas ist ein Konflikt um Ressourcen entbrannt. Mehr als ein Viertel der Waldfläche ist in den letzten 10 Jahren "verschwunden" - zum größten Teil in die Hände einflussreicher Investoren wie im Fall des Kiptagich Tea Estates des ehemaligen Präsidenten Moi. PolitikerInnen heizen das durch die Gewalt nach den Wahlen 2007/2008 fragile politische Klima weiter auf und rechtfertigen die Zwangsräumungen "illegaler" SiedlerInnen. Jäger-und-Sammler-Gemeinschaften wie die Ogiek sehen sich aus ihrem Lebensraum vertrieben. Die UNEP und UNDP üben Druck auf die kenyanische Regierung auf den Wald zu retten, dessen Zerstörung bereits jetzt Wasser-und Elektrizitätsrationierungen nach sich zieht, die Ernten verdürren lässt und verantwortlich für den Rückgang der Wildtierdichte in der Maasai Mara gemacht wird. Das Green Belt Movement versucht den Menschen in einer Region, wo Umweltschutz existentiell wird, mit seinem Modell der "Tree Nurseries" den Zusammenhang zwischen Umweltschutz und wirtschaftlichem Wohlstand aufzuzeigen und gleichzeitig durch Wiederaufforstungen der Zerstörung entgegenzuwirken. Mit den in der Mt. Kenya Region entstandenen CFA (Community Forest Associations) hat sich eine Zusammenarbeit zwischen staatlichen Waldschützern und Dorfgemeinschaften entwickelt, die Beispiel für eine verantwortungsbewusste Nutzung unseres Ökosystems sein könnte. 30. November: Korallenriffe und KlimawandelReferent: Philipp
Einem Überblick über die biologischen Grundlagen dieser Ökosysteme folgte die Darstellung der Bedeutung von Riffen für den Menschen. Der Klimawandel wirkt sich auf Riffsysteme vor allem durch die Versauerung der Ozeane, den Anstieg der Meeresspiegel, das erhöhte Risiko von Korallenbleiche und Korallenkrankheiten sowie weniger gelöstem Sauerstoff in den Weltmeeren stark negativ aus. Die Forderung eines 350 ppm CO2-Szenarios ist von diesem Standpunkt her unerlässlich. Auch wenn das Ökosystemmanagement von Riffen keine direkte Lösung für den Klimawandel bieten kann, ist es denoch essentiell für deren Weiterbestehen. Abschließend wurde exemplarisch anhand einer wissenschaftlichen Studie im Roten Meer ein integrativer Ansatz des Riff-Monitorings erläutert. 7. Dezember: Umweltpsychologie - Wie wird aus Wissen Handeln?Referent: Rainer14. Dezember: Dezentrale Systeme - Optionen für ein modernes StromnetzReferent: Jonathan
Dieses ist bislang angelegt als Übertragungsnetz von unflexiblen, großen Erzeugern (v.a. Kohle- und Atomkraftwerke) zu den Verbrauchern. Die Energie wird an relativ wenigen zentralen Standorten erzeugt und über das Hochspannungsnetz verteilt. Erneuerbare Energien unterscheiden sich von der Erzeugung von Energie aus fossilen Energieträgern oft wesentlich: Erstens sind regenerative Energien nicht überall gleich verfügbar, d.h. an Standorten mit hohem Energieverbrauch sind die Bedingungen für Sonne, Wind etc. oft nicht optimal, so dass Energie über weite Distanzen aus Gebieten großer Verfügbarkeit (Sonne in der Sahara oder Spanien; Windenergie an der Nordsee) zu Gebieten mit hohem Verbrauch transportiert werden muss. Zweitens ermöglicht das Unbundling alter Erzeugerstrukturen durch neue Gesetze und Verordnungen, wie etwa das EEG, dem Verbraucher selbst zum Erzeuger zu werden und im Optimalfall seine Energie selbst ortsnah bereitzustellen. Diese zwei Entwicklungen stellen neue Anforderungen an die Flexibilität und Komplexität des Netzes: Umgekehrte Lastströme, flukturierende Energieerzeugung (Windkraft!), steigender Energiebedarf etc. Im Vortrag wurden diese Entwicklungen aufgezeigt, kritisch beleuchtet und in der Diskussionsrunde kritisch hinterfragt. Zudem wurden beispielhaft einige (innovative?) Konzepte für ein modernes Netz vorgestellt sowie Begriffe erläutert ("Smart Grid", "Energy Hub", "Supergrid", "virtuelles Kraftwerk" …). 18. Januar: Neues und Altbekanntes über das OzonlochReferentin: MarenDas Ozonloch - interessiert uns das in Anbetracht des immer schneller voranschreitenden Klimawandels überhaupt noch? Wurden die Ursachen für die Ausdünnung der Ozonschicht nicht längst beseitigt und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis diese sich wieder vollständig erholt hat? - Prinzipiell ja, aber gerade da beim Ozonproblem so schnell und effektiv ein völkerrechtlich verbindliches Umweltschutzabkommen auf den Weg gebracht und das Problem dadurch bei der Wurzel gepackt wurde, sollten wir uns ein wenig genauer anschauen, wie dies möglich war. Anthropogen emittierte FCKWs werden die stratosphärische Ozonschicht in Zukunft zwar nicht mehr von ihrer Regeneration abhalten, doch dies bedeutet keineswegs dass dieser Prozess vollständig verstanden ist und genau vorhergesagt werden kann. Zu stark sind hierfür die Interaktionen mit anderen Faktoren - wie z.B. dem Klimawandel - und die Unsicherheiten in Bezug auf die Emissionen zusätzlicher ozonzerstörender Substanzen. In dem Vortrag werde ich erklären, warum das Schicksal des Ozonlochs im 21. Jahrhundert vor allem vom Lachgas abhängt und darauf eingehen, dass es auch natürliche Quellen für halogenierte Kohlenwasserstoffe gibt. 25. Januar: Böden und KlimawandelReferent: Christoph
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||