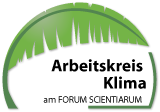|
|
Vorträge im Wintersemester 2008/2009Im Wintersemester 2008/2009 fand die zweite Vortragsreihe im Rahmen des Arbeitskreises statt. Außerdem gab es Exkursionen am 17. November, am 22. Januar und am 19. März. Zur Dokumentation gibt es auf dieser Seite eine Übersicht über die einzelnen Vorträge. Folien zu den Vorträgen gibt es nach Login hier.
20. Oktober: Wer emittiert die meisten Treibhausgase?Referent: JonasUm den Klimawandel erfolgreich bekämpfen zu können, ist eine sorgfältige Ursachenuntersuchung unabdingbar. Dieses Referat gibt einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse und Zahlen der Treibhausgasemissionen. Dabei werden zum einen die verschiedenen Länder und zum anderen die verschiedenen Sektoren miteinander verglichen. Die beiden Hauptkapitel des Referats lauten dementsprechend Ländervergleich und Sektorenvergleich. 1. LÄNDERVERGLEICH Hier ist auch hinsichtlich des Equity-Ansatzes (jeder Mensch darf gleich viel emittieren) eine Differenzierung zwischen Gesamt- und Pro-Kopf-Emissionen notwendig. Auch wenn China mit einer Gesamtemssion von rund 4,8\ Gigatonnen (Gt) CO2 nur hinter den USA (6,5\ Gt) liegt, sind sie mit 3,8\ t pro Kopf Emissionen noch weit hinter USA (22,9\ t), Indonesien (14,9\ t) oder auch Deutschland (12,4\ t) zurück. Die hohen Pro-Kopf-Emissionen von Ländern wie Indonesien oder Brasilien lassen sich im 2. SEKTORENVERGLEICH erklären. Für viele ist nämlich der hohe Anteil (18,2\ % an allen Treibhausgasemissionen) des Sektors Land Use, Land Use Change and Forestry (LULUCF) überraschend. Weltweit übersteigen die Entwaldung (Abholzung und einfaches Niederbrennen des Regenwaldes zur landwirtschaftlichen Nutzung) die Aufforstungsprojekte bei weitem. Verhinderte Entwaldung ist zwar vermutlich billig (rund 2\ $/(eingesparte t\ CO2)), aber sehr schwierig umzusetzen. Weiter wurde analysiert, wie geeignet die verschiedenen Sektoren für eine etwaige Emissionsreduzierung sind. Desweiteren wurden im Referat die unterschiedlichen Treibhausgase und ihre jeweilige Wirkung vorgestellt und anhand von Quellen gezeigt, dass der gesamte Flugverkehr anders als man häufig liest für MEHR Treibhausgasemissionen als die Internetserver verantwortlich ist. 27. Oktober: Stern-Report aus ökonomischer SichtReferent: ChristianSir Nicholas Stern war von 2000 bis 2003 Chefökonom der Weltbank; und das macht die Brisanz seines Berichts The Economics of Climate Change aus: Hier haben nicht die "üblichen Verdächtigen" die Kosten des Klimawandels untersucht, sondern ein renommierter, als neutral geltender Wirtschaftswissenschaftler. Sein Ergebnis: Effektiver Klimaschutz würde ein Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung kosten; weiter zu machen wie bisher fünf bis zwanzig Mal so viel - die Auswirkungen des Klimawandels wären viel teurer als konsequente Gegenmaßnahmen. Gleichzeitig unterstreicht Stern, dass die Schäden sehr ungleich verteilt sein werden, mit großen Kosten vor allem für die Entwicklungsländer, während reichere Staaten sich durch Anpassungsmaßnahmen eher schützen können. Die Veröffentlichung des Berichts wirbelte die Diskussion über Klimaschutz - von der Industrie häufig als zu kostenintensiv abgestempelt - komplett neu auf und gab Umweltaktivisten neuen Auftrieb in ihrer Argumentation. Dennoch bleibt anzumerken, dass die Modelle mit einem enormen Zeithorizont von mehreren Jahrzehnten auf sehr großer Unsicherheit basieren. Im Vortrag wurde das ökonomische Modell vorgestellt, dieses kritisch bewertet und die zugrundeliegenden Annahmen in einer regen Diskussion auf Herz und Nieren geprüft. Im Gegensatz zu älteren Theorien versucht Stern in sein Modell neben Erstrundeneffekten des Klimawandels auch Systemrisiken und -überraschungen einzubauen. Dabei stützt er sich auf wissenschaftliche Aussagen des letzten IPCC-Berichts. Darüber hinaus wird der Versuch unternommen sogenannte non-market impacts in die Berechnungen zu integrieren. Ein ökonomisches Modell ohne Annahmen wäre kein ökonomisches Modell: Somit entbrannte bei der Vorstellung der teilweise sehr heroischen Annahmen während des abendlichen Vortrags eine heiße Diskussion. Was heißt intergenerationale Gerechtigkeit? Wie soll die "Klimabürde" zwischen den einzelnen Ländern aufgeteilt werden? Mit welcher Zinsrate sollte man zukünftige Schäden diskontieren? In einem abschließenden Teil wurden Kosten der Vermeidung erörtert, die laut Stern von Energieeffizienzmaßnahmen (mit sogar negativen Kosten!) bis zur recht teuren Einführung von Wasserstofffahrzeugen reichen. 3. November: Energiepolitik EnBWReferenten: Marie, Roman, ValentinDer erste Teil des Vortrags beschrieb wichtige ökonomische Besonderheiten des Strommarks wie die Liberalisierung des Strommarks, vertikales und horizontales Entflechtung (Unbundling), den Merit-Order Effekt und natürlich die Wettbewerberstruktur in diesem Markt. Der zweiten Teil ging auf die Firmenpolitik und die Eigenschaften der EnBW Energie Baden-Württemberg ein. Dazu gehören ein niedrigerer CO2-Ausstoß pro Kilowattstunde im Vergleich zu den Wettbewerbern und ein starker Fokus auf Kernenergie (über 50\ %). Weiterhin wurden wichtige firmenpolitische Entscheidungen und Richtungsvorgaben der letzten Jahre vorgestellt. Das Funktionsprinzip eines Dampfkraftwerks im Hinblick auf thermodynamische und materialtechnische Beschränkungen und die resultierende Effizienz war Gegenstand des dritten Teils des Vortrags. Der Wirkungsgrad eines Steinkohlekraftwerk moderner Bauart wie in Altbach beläuft sich auf einen Wirkungsgrad von ungefähr 43\ %. Bei einer entsprechend des Wärmebedarfs der Umgebung (Industrie, Haushalte) dimensionierten Kraftwerksgröße und einem gut ausgebauten Fernwärmenetz ist durch Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) oder Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung (KWKK) eine deutliche Effizienzsteigerung möglich. Weitere Steigerungen sind mit Gasturbinen möglich, die heute mit Erdgas oder zukünftig auch mit aus Kohle erzeugtem Synthese-Gas (Kohlevergasung zu H2, sinnvollerweise kombiniert mit CCS-Technologie) betrieben werden können, und deren (heiße) Abgase wiederum in einem konventionellen Dampfprozess verwendet werden. Kohle kann aufgrund der entstehenden Asche nicht direkt in Gasturbinen verfeuert werden. Gas- und Dampfkraftwerke (GuD) erreichen bei der Verwendung von Erdgas ohne KWK Wirkungsgrade bis zu 60\ %, mit KWK sogar bis zu 90\ %. Kernkraftwerke sind Dampfkraftwerke, bei denen die Hitzeentwicklung durch Kernspaltung zur Produktion von Heißdampf verwendet wird. Neben geringem Rohstoffverbrauch und niederen Stromgestehungskosten sind CO2-Armut und Grundlastfähigkeit die größten Vorteile von Kernkraftwerken. Die CO2-Emissionen sind auf ähnlich niedrigem Niveau wie die erneuerbarer Energien oder dezentraler hocheffizienter GuD-KWK-Anlagen. Andererseits sind mit dem Abbau von Uran, dem Betrieb der Kraftwerke und der Verbreitung der zugehörigen Technologien Risiken verbunden: Der Uranabbau, häufig in Gebieten indigener Völker, hat negative Auswirkungen auf die Umwelt (Freisetzung von Radioaktivität und Schwermetallen). Weiterhin besteht die Gefahr terroristischer Angriffe und die Proliferation nuklearen Materials, besonders beim Export von Nukleartechnologie in Drittstaaten. Betrachtet man den weltweiten Energiebedarf, so erscheint es sehr schwierig, nennenswerte Anteile langfristig durch Kernspaltung zu decken. Viele Projektionen gehen von einem Rückgang nuklearer Energieerzeugung aus. Dabei sind die höheren Investitionskosten im Vergleich zu Kohlekraftwerken und der durch einen Ausbau steigende Uranverbrauch zu berücksichtigen. Kernfusionskraftwerke könnten im Erfolgsfall frühestens in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts, eher aber später verfügbar sein und würden zunächst eine kleinere Rolle spielen. Schließlich würden durch den Weiterbetrieb von Kernkraftwerken das Oligopol der großen Versorger gestärkt und Innovationen zurückgedrängt. Beispielsweise wären dezentrale Kraftwerke, die gut für KWK geeignet sind, dann weniger rentabel. Allerdings ist fraglich, ob erneuerbare Energie zu ökonomisch vertretbaren Bedingungen schnell genug zur Substitution der konventionellen Kraftwerke zur Verfügung stehen und ob die Energieeffizienz rascher als bisher erhöht werden kann. 10. November: Tropische EntwaldungReferent: LionEmissions from land use change (LUC) account for roughly a fifth of global anthropogenic greenhouse gas (GHG) emissions. The vast majority (>\ 90\ %) of these emissions stem from tropical deforestation, mainly from Brazil and Indonesia. In many temperate regions forest cover increases, especially in China but also in Spain and the US. Abatement costs are often thought to be relatively low in the forestry sector compared to the energy system, especially avoided deforestation in the tropics, where opportunity costs of land are often low. For example, the IPCC (2007) estimates that for $2.7/t\ CO2\ +\ 5\ %\ p.a. about 2\ Gt\ C could be sequestered per year over the 21st century, which is about a quarter of today's anthropogenic emissions and more than current LUC emissions (current ETS market prices are around $25). In addition, externalities of avoided deforestation are believed to be positive and high, especially regarding to biodiversity. Low costs and positive externalities make REDD an attractive abatement option. While being often cited as an attractive mitigation option, reducing tropical deforestation is not covered by the Kyoto protocol. No single tropical country is listed in the Annex-I and avoided deforestation is excluded from the Clean Development Mechanism (CDM), the mechanism that links reductions in non-Annex-I parties to Annex-I commitments. The main reasons for this decision are issues related to scale, non-permanency, leakage, measurement, and the determination of a baseline. Afforestation projects are possible CDM projects, but since they are excluded from the European Emission Trading Scheme (ETS), there is only minuscule demand. Indeed, there has been only a single CDM afforestation project so far. Note that Annex-I parties themselves are obligated to account their LUC emissions, including deforestation. 24. November: Wasserkriege?Referent: Jonathan
(1) Die Folgen des Klimawandels auf den globalen WasserkreislaufDie globale Erwärmung führt zu einer Intensivierung des Wasserkreislaufs. Natürliche Wasserspeicher wie Gletscher oder Seen nehmen ab, durch sie gespeiste Flußsysteme drohen auszutrocknen. Parallel zur Gefahr des Wassermangels im Sommer steigt jedoch in vielen Regionen auch die Regenmenge, so dass mit Überflutungen zu rechnen ist. Dies hat Einfluss auf die Wasserversorgung vieler Menschen, deren Gesundheit, das Funktionieren des Ökosystems und den Wirtschaftskreislauf … (2) Bedeutung von Wasser für den MenschenDer Wasserverbrauch des Menschen ist enorm. Viele Produkte 'verbrauchen' bei der Produktion Unmengen an Wasser:
Dieses Wasser wird auch als virtuelles Wasser bezeichnet; es gibt bereits Ansätze, die den Handel mit virtuellem Wasser als eine mögliche Lösung für die ungleiche Verteilung des "kostbaren Naß" anstreben. (3) Das Konfliktpotential von WasserStudien der Konfliktforschung ergeben, dass Wasser bislang alleine selten Auslöser für unkooperative Konflikte gewesen ist. Meist handelt es sich um Wasserverteilungskonflikte, in denen Wasser ein Konfliktstoff unter mehreren ist, z.B. bei ethnischen oder nationalen Auseinandersetzungen. Die meisten Konflikte spielen sich (bislang) nicht auf zwischenstaatlicher Ebene, sondern auf substaatlicher Ebene ab – d.h. es gibt Verteilungskonflikte zwischen den verschiedenen Nutzergruppen um den Zugang zu Wasser (z.B. Viehhirten vs. Industrie). Es ist jedoch zu vermuten, dass Konflikte um Wasser in Zukunft zunehmen werden – es bleibt jedoch abzuwarten, ob sie wie im "Nilsystem" kooperativ gelöst werden können, oder in gewaltsamen Konflikten ausgetragen werden. — Jonathan Gauß, 10.12.2008 15:05 MaterialDie Arbeitsblätter sowie weitere Materialien finden sich im internen Bereich. Weblinks
1. Dezember: CCS (Carbon Dioxide Capture and Storage)Referenten: Carina und ChristophCCS (carbon capture and storage) ist eine Strategie zur Vermeidung von CO2–Emissionen bei der Verbrennung fossiler Rohstoffe zur Stromerzeugung. Im ersten Teil des Vortrags erklärte Carina die CCS-Technologie, die eine ganze Prozesskette von der Abscheidung des CO2 über den Transport bis zur Speicherung umfasst. Es wurden drei verschiedene Verfahren zur CO2–Abscheidung im Kraftwerksprozess vorgestellt. Im Post-combustion-Verfahren, wird das CO2 nach dem Verbrennungsprozess aus den Abgasen ausgewaschen. Eine andere Möglichkeit ist die Abscheidung vor dem Verbrennungsprozess im Pre-combustion-Verfahren. Die dritte Technik ist das sogenannte Oxyfuel-Verfahren, bei dem das Brennmaterial mit reinem Sauerstoff verbrannt wird, sodass die Abgase überwiegend aus Wasserdampf und CO2 bestehen, welches leicht abgetrennt werden kann. Im Anschluss an die Abscheidung muss das CO2 zum Speicherort transportiert werden. Am sinnvollsten ist der Transport in flüssigem Zustand in Pipelines. Carina stellte verschiedene Speicheroptionen vor. Derzeit technisch nutzbar sind vor allem ehemalige Erdöl- und Erdgaslagerstätten, dort kann die Einleitung von CO2 zur Erhöhung der Rohstoffausbeute führen. Auch in nicht förderbaren Kohleflözen kann CO2 gespeichert werden. Als wichtigster Speicher werden salzwasserführende Gesteinsschichten angesehen. Im zweiten Teil des Vortrags beschäftigte sich Christoph mit dem Potential der CCS-Technologie und ihren Risiken. So ist CCS mit hohen Kosten und Einbußen beim Wirkungsgrad verbunden, und die Reichweite der Speicheroptionen in Deutschland beträgt nur 40–70 Jahre. Ein Defizit besteht bei der Abschätzung von Folgen der Speicherung. Hier besteht noch großer Forschungsbedarf. Eine rechtliche Grundlage wird zur Zeit auf EU-Ebene erarbeitet. Obwohl schon Pilotanlagen betrieben werden und Kraftwerke mit CCS-Technik in Bau sind, wird mit einem großtechnischen Einsatz von CCS nicht vor 2020 gerechnet. Im Anschluss an den Vortrag wurden Positionspapiere von verschiedenen Umweltverbänden, öffentlichen Behörden und Interessengemeinschaften zum Thema CCS in Gruppen bearbeitet und diskutiert. Weitere InformationenIPCC Special report on CCS von 2005 Publikationen des Wuppertal Instituts zum Thema CCS Technische Abscheidung und Speicherung von CO2 – nur eine Übergangslösung Positionspapier des Umweltbundesamtes zu möglichen Auswirkungen, Potenzialen und Anforderungen Die EU Umwelt-Kommission zum Thema CCS Fotos8. Dezember: Klimafaktor LandwirtschaftReferentin: Dorothee15. Dezember: Wirkungsweise der TreibhausgaseReferentin: Lisa19. Januar: Zukunft des Autos und der EnergiespeicherungReferent: Mirko
Die folgenden Energiespeicher sind derzeit vorhanden, einige mehr, einige weniger ausgereift:
Sie wurden im Vortrag vorgestellt und verglichen. Dabei wurde auf die verschiedenen Akku-Typen und die Probleme der Wasserstoffherstellung eingegangen. Es stellt sich heraus, dass Hybride und Elektroautos derzeit besser dastehen, als mit Wasserstoff betriebene Fahrzeuge. Um Elektroautos attraktiver zu machen, können politische Maßnahmen hilfreich sein. Die These: "Ökostrom sollte genutzt werden um alte Kohlekraftwerke abzuschalten und erst anschließend um Autos anzutreiben" wurde diskutiert. Anschließend wurde eine Prognose auf die Entwicklung in naher und ferner Zukunft gegeben. 26. Januar: Verantwortung für die Schöpfung? Der Klimawandel aus theologisch-ethischer PerspektiveReferent: TobiasDer Vortrag gliederte sich im Wesentlichen in zwei Teile: Nach einigen grundsätzlichen ethischen Überlegungen wurden die biblischen Schöpfungsaussagen näher betrachtet, wobei der Fokus vor allem auf den beiden Herrschafts- und Verantwortungsaufträgen (Gen 1,28 und Gen 2,15) lag. Abschließend wurden in verschiedenen Kleingruppen Stellungnahmen der beiden großen Kirchen in Deutschland zur Umweltproblematik diskutiert. Grundsätzlich kann man zwei Extrempositionen hinsichtlich der Reaktion auf den Klimawandel unterscheiden: einige reagieren chiliastisch und ergeben sich so in ein Schicksal mit ungewissem Ausgang. These: Der Mensch kann ohnehin nichts ausrichten. Andere wiederum vertrauen stark der menschlichen Erfindungskraft und auf künftige Lösungen für Probleme, die vom Menschen heute geschaffen werden. Theologisch-ethisch wird man beide Extrempositionen als Irrtümer einstufen müssen, es geht vielmehr um eine freiwillige Selbstbegrenzung des Menschen unter dem Gesetz der Schöpfung Gottes. Maßstäbe hierfür könnten entweder die menschliche Klugheit sein, über Wertvorzugsüberlegungen bzw. Kosten-Nutzen-Abwägungen zu einer verantwortlichen Einschätzung zu kommen (teleologische Argumentationsweise). Oder aber man legt die sog. "Ehrfurcht vor dem Leben" (A. Schweitzer) zugrunde, und misst so dem Leben allgemein (nicht nur dem Menschen) einen absoluten Wert zu, den es unter allen Umständen zu schützen gilt (deontologische Argumentationsweise). Die Herrschaftsaussage des zweiten Schöpfungsberichts der Bibel: „Und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaue und bewahre.“ (Gen 2,15) ist dabei relativ unproblematisch. Der Verantwortungsaspekt des Menschen ist durch das "Bebauen und Bewahren" deutlich. Die Herrschaftsaussage des ersten Schöpfungsberichts der Bibel: „Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht.“ (Gen 1,28) ist hingegen offensichtlich durch das "herrschet und machet sie Euch untertan" nicht ganz so unproblematisch. Die Deutung dieser Stelle hängt im Wesentlichen am Verb "herrschen", was sich im Hebräischen entweder mit "niedertreten" oder mit "führen und begleiten" übersetzen lässt. Beides wird in der Forschung vertreten. Wesentlich ist jedoch die Rückbindung an die Ebenbildlichkeitsaussage unmittelbar zuvor in Gen 1,27. Legt man zugrunde, dass der Mensch nach dem Bilde Gottes geschaffen ist (womit sowohl eine Wesensähnlichkeit als auch eine leibliche Ähnlichkeit gemeint sein kann), so muss die Intention unterstellt werden, dass der Mensch als Ebenbild Gottes mit der Schöpfung verantwortlich, im Sinne Gottes umgehen soll. Entscheidend ist dann, welches Gottesbild zugrunde gelegt wird, wobei man sicher nicht zu weit geht, wenn man sagt, dass das Gottesbild sowohl des Alten als auch des Neuen Testaments in Summe kein die Schöpfung zerstörendes und Ausbeuterisches ist. In der Gruppenarbeit fanden sich in den kirchlichen Stellungnahmen sowohl deontologische Aussagen absoluten Schutzes der Schöpfung, als auch teleologisch abwägende Aussagen, die nach den positiven wie negativen Folgen menschlichen Handelns fragen. 2. Februar: Politische Antworten auf die Klimawirkungen des LuftverkehrsReferentin: OdetteDer Luftverkehr trägt in steigendem Maße zum globalen Klimawandel bei. Obwohl der Anteil des Luftverkehrs an der Gesamtmenge an den weltweiten CO2-Emissionen noch gering ist (ca. 2\ %), untergräbt das schnelle Wachstum (4–5\ % jährlich) die in den anderen Sektoren erzielten Minderungsanstrengungen. Hinzu kommt, dass die Klimawirksamkeit des Luftverkehrs über die der luftverkehrsbedingten CO2-Emissionen hinausgehen: in Reiseflughöhe emittierte Stickoxide begünstigen die Bildung des Treibhausgases Ozon und reduzieren Methan. Die Flugzeugemissionen lösen die Bildung von Kondensstreifen aus und stehen im Verdacht die Bildung von Zirruswolken zu fördern. Nach dem derzeitigen Stand der Wissenschaft beträgt der Strahlungsantrieb des Luftverkehrs insgesamt das 2- bis 5-fache des CO2 Strahlungsantriebs des Luftverkehrs. Der IPCC erkennt den Strahlungsantrieb als ein grobes Maß für die Quantifizierung der luftverkehrsbedingten Klimaeffekte an. Während das Global-Warming-Potential als Metrik für langlebige Treibhausgase durch das Kyoto Protokoll auch politisch anerkannt ist, gibt es bislang keine anerkannte Metrik zum Vergleich der kurz- und langlebigen Klimaeffekte, wie sie im Luftverkehr auftreten, die als Grundlage für politische Maßnahmen dienen könnte. Über die besonderen Klimaeffekte hinaus gibt es verschiedene sektorspezifische Eigenschaften, die die Einführung klimapolitischer Instrumente erschwert. Beispielsweise treten Schwellenländer als Global Players im international sehr wettbewerbsintensiven Luftverkehrsmarkt auf, so dass das UNFCCC Prinzip der differenzierten Verantwortlichkeit zwischen Industrie- und Entwicklungsländer eine große Herausforderung bei der Verpflichtungsarchitektur darstellt. Der internationale Luftverkehr wurde von den verbindlichen Minderungsverpflichtungen des Kyoto Protokolls ausgenommen, da eine Allokation der Emissionen, anders als in anderen Sektoren, nicht nach dem Territorialprinzip vorgenommen werden kann. Des Weiteren weichen institutionelle Strukturen unter UNFCCC im Luftverkehr von den anderen Sektoren ab: Es gibt eine geteilte Verantwortlichkeit zwischen UNFCCC und der International Civil Aviation Organisation – zwei Institutionen mit sehr unterschiedlichen Prinzipien und Zielrichtungen. Derzeit werden Optionen für eine post-2012 Regime unter Einbeziehung des internationalen Luftverkehrs verhandelt. Im Gespräch sind ein sektoraler Ansatz, d.h. dass der Luftverkehr von anderen Sektoren getrennt behandelt wird und ein System unter UNFCCC bei dem verschiedene Ländergruppen (Industrie-, Schwellen- und Entwicklungsländer) unterschiedlich weitgehende Politiken und Maßnahmen sowie Ziele etablieren müssen und eine Allokation der Emissionen an die Nationalstaaten vorgenommen wird. Eine Option, die moralisch sehr überzeugend wirkt, sieht vor, dass die Erlöse aus einem globalen Luftverkehrsystem unter Einbeziehung aller Staaten der Anpassung in den Entwicklungsländern zugute kommen. Auf diese Weise könnte man zwei großen Herausforderungen bei den Klimaverhandlungen begegnen: die Begrenzung des Luftverkehrs auf globaler Ebene sowie die Etablierung eines innovativen globalen Finanzierungsinstruments für die Anpassung an den Klimawandel. Alle Folien können im internen Bereich eingesehen werden. |