Klima-Workshop mit Prof. Dr. Hartmut Graßl
Am 8. Januar 2010 veranstaltete der Arbeitskreis Klima einen halbtägigen Workshop mit dem emeritierten Direktor des Max-Planck-Institutes für Meteorologie in Hamburg, Prof. Dr. Hartmut Graßl. Ziel des Workshops war es, Klimainteressierten aller Fächer ein tiefergehendes Verständnis der naturwissenschaflichen Grundlagen des Klimawandels zu vermitteln. Natürlich sollte wenige Wochen nach der Klimakonferenz von Kopenhagen auch die internationale Klimapolitik nicht zu kurz kommen. Wir freuen uns, dass wir einen der renommiertesten deutschen Klimaforscher für diesen Workshop gewinnen konnten.
Prof. Dr. Hartmut Graßl
 Prof. Graßl wurde 1940 in Salzberg bei Berchtesgaden geboren. Er studierte Physik und Meteorologie und promovierte 1970 in München. 1978 habilitierte er sich an der Universität Hamburg, an der er von 1989 bis 2005 als Professor im Meteorologischen Institut lehrte. Außerdem war er von 1989 bis 2005 Direktor am Max-Planck-Institut für Meteorologie. Von 1994 bis 1999 leitete Prof. Graßl das Weltklimaforschungsprogramm der World Meteorological Organization (WMO) bei den Vereinten Nationen in Genf. Nach 1992-1994 hatte er von 2001 bis 2004 erneut den Vorsitz des Wissenschaftlichen Beirates Globale Umweltveränderungen (WBGU) der Bundesregierung inne. Seine Forschungsgebiete umfassen die Erdbeobachtung aus dem Weltraum, Aerosol- und Klimaforschung sowie die Fernerkundung der unteren Atmosphäre mit Lidar- und Radarmethoden. Desweiteren machte er sich in den Verhandlungen über das Kyoto Protokoll verdient. Prof. Graßl ist Mitglied zahlreicher wissenschaftlicher Gremien sowie Träger hoher Auszeichnungen. Gemeinsam mit seinen Kollegen Prof. Dr. Lennart Bengtsson und Prof. Dr. Klaus Hasselmann vom Max-Planck-Institut für Meteorologie erhielt er 1998 den Deutschen Umweltpreis der Deutschen Bundesstiftung Umwelt.
Prof. Graßl wurde 1940 in Salzberg bei Berchtesgaden geboren. Er studierte Physik und Meteorologie und promovierte 1970 in München. 1978 habilitierte er sich an der Universität Hamburg, an der er von 1989 bis 2005 als Professor im Meteorologischen Institut lehrte. Außerdem war er von 1989 bis 2005 Direktor am Max-Planck-Institut für Meteorologie. Von 1994 bis 1999 leitete Prof. Graßl das Weltklimaforschungsprogramm der World Meteorological Organization (WMO) bei den Vereinten Nationen in Genf. Nach 1992-1994 hatte er von 2001 bis 2004 erneut den Vorsitz des Wissenschaftlichen Beirates Globale Umweltveränderungen (WBGU) der Bundesregierung inne. Seine Forschungsgebiete umfassen die Erdbeobachtung aus dem Weltraum, Aerosol- und Klimaforschung sowie die Fernerkundung der unteren Atmosphäre mit Lidar- und Radarmethoden. Desweiteren machte er sich in den Verhandlungen über das Kyoto Protokoll verdient. Prof. Graßl ist Mitglied zahlreicher wissenschaftlicher Gremien sowie Träger hoher Auszeichnungen. Gemeinsam mit seinen Kollegen Prof. Dr. Lennart Bengtsson und Prof. Dr. Klaus Hasselmann vom Max-Planck-Institut für Meteorologie erhielt er 1998 den Deutschen Umweltpreis der Deutschen Bundesstiftung Umwelt.
Externe Links:
-
scobel auf 3sat: Interessante 60min-Sendung auf 3sat, bei der renommierte Klimaforscher zu Gast sind und in Interviews über den Klimawandel informieren, u.a. mit Prof. Graßl. Die ganze Sendung ist in der 3sat Mediathek einzusehen.
Programm
12:00 Uhr: Wie weist man den anthropogenen Klimawandel nach?
Wie belastbar sind die Proxy-Daten? (Hans von Storch, Michael Mann, Temperaturanstieg zeitlich vor CO2-Anstieg in Wostock-Eiskern-Daten)?
Wie hoch ist die Unsicherheit in der Umrechnung Emission → Konzentration → Temperatur
Wie sicher sind natürliche Klimafaktoren erforscht? (z.B. Melankovic-Zyklen)
Wie geht man mit kurzfristen Wetterphänomen (z.B. jetziger Temperaturstagnation, nordatlantische Oszillation) in Modellen um? Wo ist der Unterschied zu echten abrupten Klimaänderungen (z.B. Dansgaard, Oeschger)?
13.15 Uhr: Kaffeepause
13.45 Uhr: Wolken & Aerosole
Geographische Verteilung (inkl. Messmethoden)
Erwärmende oder abkühlende Wirkung?
Neue Erkenntnisse über zeitliche Entwicklung von Wolkenbedeckung?
Eventuell: Ankopplung an globalen Energie- und Wasserkreislauf
15.00 Uhr: Kaffeepause
15:30 Uhr: Klimamodellierung
Gewichtung von Einflussfaktoren
Umgang mit Unsicherheiten
Wie gut ist regionale Auflösung bereit (z.B. bei Niederschlag)?
16:30 Uhr: Kaffeepause
17:00 Uhr: Klimapolitik
Woher kommt das 2°-Ziel, gibt es dafür eine wissenschaftliche Begründung, oder ist es nur ein politisches Ziel?
Was bedeutet es in ppm? (Dürfen kurzfristig 450 ppm überschritten werden?)
Geschichte der Klimaforschung
Fragen zu Klimapolitik
Teilnahme
Zeit: Freitag, 8. Januar, 12-18 Uhr
Ort: Forum Scientiarum, Hörsaal 1.3
Der Workshop ist offen für Studierende aller Fächer. Grundkenntnisse der Klimaforschung auf Wikipedia Niveau werden vorausgesetzt (und in der optionalen Vorbereitung am Donnerstag gemeinsam erarbeitet).
Wir freuen uns sehr über das große Interesse an der Veranstaltung! Leider können wir keine weiteren Teilnehmer mehr aufnehmen.
☛ Teilnehmerliste (nach Login)
Optionales Vorbereitungstreffen
Zeit: Donnerstag, 7. Januar, ab 18.30 Uhr
Ort: Forum Scientiarum, Hörsaal 1.3
Zur Vorbereitung auf den Workshop wollen wir uns Grundkenntnisse der Klimaforschung gemeinsam erarbeiten. Auch hierzu ist jeder herzlich willkommen!
| Thema | Referent |
| Einführung Treibhauseffekt, Aufbau der Atmosphäre | Bianca |
| Absorption, Reflexion, Streuung | Rainer |
| Strahlungshaushalt, Absorptionseigenschaften der Treibhausgase, Strahlungsantrieb und Global Warming Potential | Dorothee |
| Methoden: Fernerkundung, Isotopengrundlagen | Urs |
| Paläoklimatologie: CO2-Konzentration und Klima in der Erdgeschichte | Kathi, Christoph |
| Grundkonzepte Modellierung | Jonas |
Literatur
Publikationen von H. Graßl
[alle Artikel über UB Tübingen zugänglich]
Zur Frage des 2 °C-Ziels:
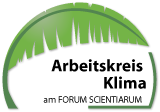
 Prof. Graßl wurde 1940 in Salzberg bei Berchtesgaden geboren. Er studierte Physik und Meteorologie und promovierte 1970 in München. 1978 habilitierte er sich an der Universität Hamburg, an der er von 1989 bis 2005 als Professor im Meteorologischen Institut lehrte. Außerdem war er von 1989 bis 2005 Direktor am
Prof. Graßl wurde 1940 in Salzberg bei Berchtesgaden geboren. Er studierte Physik und Meteorologie und promovierte 1970 in München. 1978 habilitierte er sich an der Universität Hamburg, an der er von 1989 bis 2005 als Professor im Meteorologischen Institut lehrte. Außerdem war er von 1989 bis 2005 Direktor am